
Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren
 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO  Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO




 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO  Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO


Unser Team steht schon lange für lokale Expertise,
Herzblut, digitalen Vorsprung und gelebte Start-Up-Kultur.
So sichern wir den maximalen Mehrwert für unsere Kunden -
Lernen Sie uns kennen.
Matthias Wedel, CEO
Unser Team steht schon lange für - lokale Expertise, Herzblut, digitalen Vorsprung und
gelebte Start-Up-Kultur - so sichern wir den maximalen Mehrwert für unsere Kunden - Lernen Sie uns kennen.
Matthias Wedel, CEO
 Matthias Wedel
CEO
Matthias Wedel
CEO
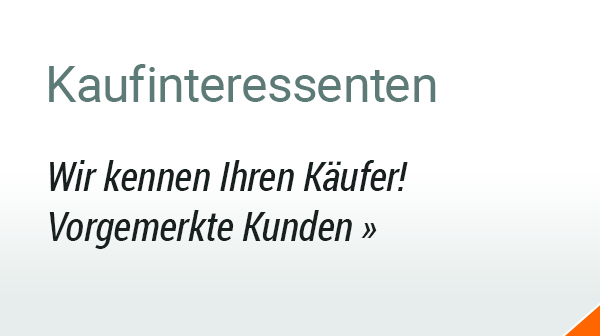
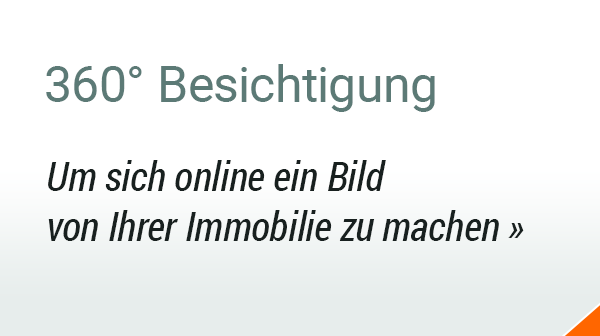
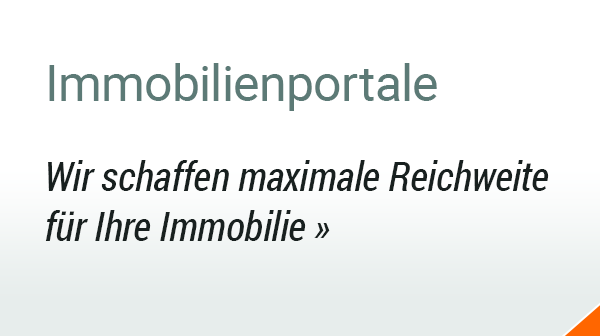
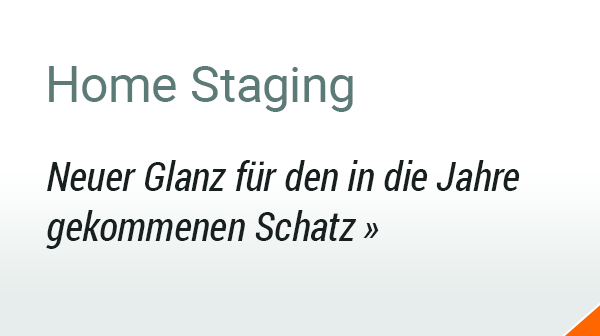
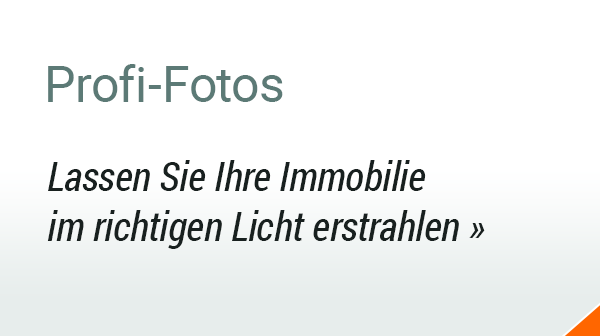
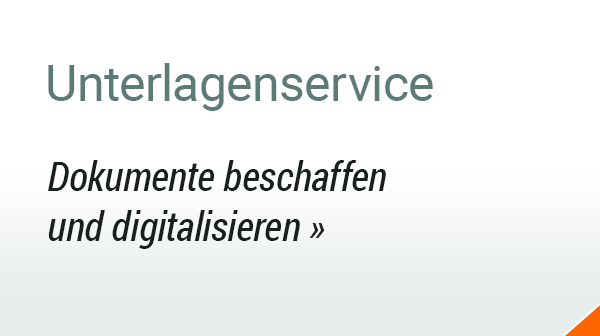
 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO  Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO
 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO
Wir waren mit der Abwicklung des Verkaufes von unserem Haus sehr zufrieden. Unsere Bearbeiterin war in allen Belangen sehr nett und hilfsbereit. Sie hat uns unterstützt und stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir würden die Immobilienmakler Agas immer wieder beauftragen und immer weiter empfehlen.
Ich wurde von Frau Dannenbring sofort kontaktiert, nachdem ich eine Kontaktanfrage für eine Mietpreiseinschätzung geschickt hatte. Sie war während des gesamten Prozesses sehr freundlich und professionell und ich kann Agas nur jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem guten und verantwortungsvollen Immobilienmakler in der Stadt ist ...
Herr Berg war uns auf dem Weg eine Immobilie zu erwerben eine große Bereicherung. Seine Expertise & unglaublich freundliche Art haben uns in diesem Prozess sehr geholfen. Von Beginn, bis zum Schluss war Herr Berg stets erreichbar, selbst im Urlaub! Sein umfangreicher Service und die großartige Vorbereitung in jeglichem Aspekt hat uns sehr beeindruckt. Wir wissen dies sehr zu schätzen und würden uns immer wieder für Agas Immobilien entscheiden ...
Vielen Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Herr Soldanski hat uns äußerst kompetent bei der Vermietung unserer Immobilie unterstützt. Es ging alles wunderbar unkompliziert und zügig vonstatten. Ich kann die Zusammenarbeit mit Agas Immobilien nur empfehlen.
Wir wurden bereits vor der Besichtigung sehr ausführlich von Herrn Berg informiert. Auch der Besichtigungstermin war durchweg professionell. ... Auch weiterführende Fragen konnten zu unserer Zufriedenheit beantwortet werden. Herr Berg war auch während der Abwicklung des Mietvertrages mit dem Vermieter für uns erreichbar, was ein durchgängig positives Gefühl bei uns zurücklässt. Wir würden Agas Immobilien durchaus weiter empfehlen und wieder nutzen!
Nach zuvor nicht ganz so positiven Erfahrungen mit einem anderen Immobilienunternehmen habe ich mich entschieden, zu Agas Immobilien zu wechseln. Es war die richtige Entscheidung! Ein ganz großes Dankeschön an Herrn Soldanski, der den Verkauf meiner Wohnung sehr kompetent über die Bühne gebracht hat. Er war jederzeit erreichbar, immer sehr freundlich und mit Rat und Tat zur Stelle. Besser geht es nicht!!!!
Super schnell in der Kommunikation! Organisation der Termine verlief einwandfrei und schnell! Über das Objekt hatte sich Frau Dannenbring im Vorfeld perfekt vorbereitet! Bei anderen Maklern hatte ich andere gegenteilige Erfahrungen! Fragen wurden entsprechend perfekt beantwortet! Kann ich nur weiterempfehlen!!!
Eine perfekte Geschäftsbeziehung. Kompetent, zugewandt, zuverlässig, zielgerichtet und immer ansprechbar. Wir sind sehr zufrieden und empfehlen Herrn Soldanski gerne und jederzeit weiter. Andrea und Guntram Frühauf
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ivo Berg von Agas Immobilien bedanken - er hat uns von Anfang an ein positives Gefühl bei der Wohnungssuche vermittelt: Er war jederzeit erreichbar, verlässlich, kompetent und hilfreich. An Informationen und Hilfe hat es nie gefehlt. Wir würden Herrn Berg von Agas Immobilien jederzeit weiter empfehlen!
Herr Pillardy war und ist definitiv ein großer Segen für uns. Die besonderen Faktoren beim Verkauf unseres Hauses hat er vollumfänglich erkannt und dem entsprechend ruhig und professionell agiert. Mit dem Ergebnis sind wir hoch zufrieden. Daher empfehlen wir die Agas Immobilien GmbH sehr klar.
 Immobilienmakler Matthias Wedel CEO
Immobilienmakler Matthias Wedel CEO  Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO
... der Oder gelegene kreisfreie Stadt im östlichen Brandenburg. Die polnische Nachbarstadt Słubice entstand 1945 aus dem Frankfurter Stadtteil Dammvorstadt. Seit 1999 führt Frankfurt die
Zusatzbezeichnung „Kleiststadt“ nach ihrem berühmtesten Sohn Heinrich von Kleist. Mit der Neugründung der Europa-Universität Viadrina 1991 ist Frankfurt (Oder) wieder eine
Universitätsstadt.
Frühere Formen des Ortsnamens Frankfurt waren „Vrankenforde“ (1253), „Frankenforde“, „Francfurd“ bzw. „Franckfurde“ und „Franckfurt an der Oder“ (1706). Angenommen wird dabei eine
Namensübertragung von Frankfurt am Main.
Geographie
Frankfurt liegt im Osten Deutschlands, im Süden der Landschaft Lebus. Im Norden grenzt es an den Landkreis Märkisch-Oderland, im Süden und Westen an den Landkreis Oder-Spree. Die Oder
bildet die östliche Stadtgrenze und zugleich die deutsche Staatsgrenze zu Polen. Auf dem anderen Ufer des Flusses befindet sich Słubice, das aus dem ehemaligen Frankfurter Stadtteil
Dammvorstadt hervorgegangen ist.
Die Stadt liegt in der brandenburgischen Auen-, Wald- und Seenlandschaft auf 22–56 m ü. NHN; die Stadtmitte liegt auf etwa 27 m ü. NHN. Höchste Erhebung sind die Hirschberge mit 135 m ü.
NHN. Der 250 Hektar große und 56,63 m tiefe Helenesee liegt inmitten von märkischen Kiefernwäldern und ist ein beliebtes Freizeitgebiet. Wegen der interessanten Bodenbeschaffenheit ist
dieser See bei den Tauchern sehr beliebt. Der Helenesee entstand aus einem früheren Braunkohletagebau, dem sogenannten Helene-Schacht. Ihm angrenzend befand sich der Katja-Schacht. Beide
Schächte wurden in den 1960er Jahren geflutet und sind heute durch einen Kanal verbunden. Frankfurt liegt im Grundmoränengebiet des Warschau-Berliner-Urstromtals.
Stadtgebiet
Die Stadt hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 14 Kilometern und eine Ost-West-Ausdehnung von 10,5 Kilometern. Der Umfang des Stadtgebietes beträgt 66,8 Kilometer.
Stadtgliederung
1: Stadtmitte, 2: Gubener Vorstadt, 3: Obere Stadt, 4: Altberesinchen, 5: Neuberesinchen, 6: Güldendorf, 7: Lossow, 8: Lebuser Vorstadt, 9: Hansaviertel, 10: Klingetal, 11: Kliestow, 12:
Booßen, 13: Nuhnenvorstadt, 14: Rosengarten/Pagram, 15: Lichtenberg, 16: Süd, 17: Markendorf, 18: Markendorf-Siedlung, 19: Hohenwalde
I: Stadtmitte, II: Beresinchen, III: Nord, IV: West, V: Süd
Das Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) wird in fünf Teile gegliedert; Zentrum mit den Stadtteilen Stadtmitte, Gubener Vorstadt und Obere Stadt; Beresinchen mit den Stadtteilen
Altberesinchen und Neuberesinchen und den Ortsteilen Güldendorf und Lossow; Nord mit den Stadtteilen Lebuser Vorstadt, Hansaviertel und Klingetal und den Ortsteilen Kliestow und Booßen;
West mit dem Stadtteil Nuhnenvorstadt und den Ortsteilen Rosengarten/Pagram und Lichtenberg und Süd mit dem Stadtteil Süd und den Ortsteilen Markendorf, Markendorf-Siedlung und
Hohenwalde.
Nachbargemeinden
Frankfurt (Oder) grenzt (im Uhrzeigersinn, von Norden beginnend) an Treplin, Lebus (beide im Landkreis Märkisch-Oderland), Słubice (Polen), Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow, Müllrose,
Briesen (Mark) und Jacobsdorf (alle im Landkreis Oder-Spree).
Klima
Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt im langjährigen Mittel 10,6 °C bei einer Sonnenscheindauer von 1.860 Stunden. Die durchschnittliche Temperatur beträgt im Januar 1,3 °C. Im Juli beträgt die Temperatur im langjährigen Mittel 19,7 °C. Im August beträgt die Temperatur im langjährigen Mittel 20 °C und die Niederschlagsmenge 37 mm. Die Sonnenscheindauer beträgt hier knapp 245 Stunden. Im September liegt die mittlere durchschnittliche Temperatur bei 15,3 °C bei einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 34 mm. Im Oktober beträgt die mittlere durchschnittliche Temperatur 10,1 °C bei einer mittleren Niederschlagsmenge von 47 mm. Durchschnittlich scheint die Sonne 110–120 Stunden. Im Oktober 2005 schien sie allerdings 180 Stunden. Frankfurt (Oder) war gemäß der Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes im Jahr 2009 mit einer Niederschlagsmenge von 100 Millimeter innerhalb 24 Stunden (gemessen am 4. Juli 2009) der Ort in Deutschland mit den heftigsten Niederschlägen. Der November bringt eine Durchschnittstemperatur von 5,6 °C. In zehn bis zwölf Nächten kommt es zu Frost. Mitte November ist erster Schneefall möglich, die Niederschlagsmenge liegt für den Monat im Durchschnitt bei 39 mm. Die Sonnenscheindauer beträgt 50–55 Stunden, an sechs bis acht Novembertagen muss mit Nebel gerechnet werden.
Gewässer
Frankfurt (Oder) liegt an dem Fluss Oder. Die Alte Oder und der Winterhafen entstammen dem ehemaligen Verlauf des Flusses und bilden dessen Seitenarme. Die Stadt Frankfurt (Oder) hat eine Wasserfläche von 577 ha und es gibt 98 Seen und Teiche sowie 178 Fließgewässer und Gräben. Der niedrigste jemals gemessene Pegelstand der Oder waren 86 cm am 8. August 1950. Seit Beginn der Aufzeichnungen am 7. Oktober 1910 wurde der höchste Pegelstand beim Oderhochwasser 1997 mit 657 cm gemessen. Bis dahin waren 635 cm vom 7. November 1930 der Höchststand.
Naturdenkmale
→ Hauptartikel: Liste der Naturdenkmale in Frankfurt (Oder) Auf dem Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) und seiner Ortsteile wurden am 21. Juli 1999 per Verordnung 84 Bäume und Baumgruppen der Arten Silber-Ahorn, Rotbuche, Europäische Eibe, Stieleiche (auch als Säuleneiche), Sumpf-Eiche, Wintergrüne Eiche (Quercus × turneri, Kreuzung aus Stieleiche und Steineiche), Schwarz-Erle, Ginkgo, Schwarzer Holunder, Edelkastanie, Gewöhnliche Rosskastanie, Sommerlinde, Weiße Maulbeere, Schwarz-Pappel, Silber-Pappel, Ahornblättrige Platane, Japanischer Schnurbaum, Flatterulme, Chinesische Weide (in Kulturform Korkenzieher-Weide), Silber-Weide (in Zuchtform Trauerweide), Eingriffeliger Weißdorn (in Form Rotdorn) und Europäischer Zürgelbaum, einer Hickory- und einer Kirschbaumart zu Naturdenkmalen erklärt.
Geschichte
Mittelalter
Nach 1200 entwickelte sich auf einer Talsandinsel an einer schmalen Stelle der Oder eine Kaufmannssiedlung. Sie lag an der Kreuzung mehrerer Fernhandelsstraßen. Herzog Heinrich I. von
Schlesien verlieh ihr 1225 das Markt- und Niederlagsrecht. Der Zuzug reicher Fernhändler aus Nordwestdeutschland und Flandern verstärkte sich. Der Schultheiß Gottfried von Herzberg
verhandelte mit Markgraf Johann I. auf der Burg Spandau über die Verleihung des Stadtrechts. Markgraf Johann I. stellte am Samstag, den 12. Juli 1253 die Urkunde zur Stadtgründung aus. Es
sollte das Berliner Stadtrecht gelten, das vom Magdeburger Stadtrecht abgeleitet war. Am 14. Juli 1253, dem Montag darauf, wurde eine ergänzende Urkunde ausgefertigt. Diese Urkunde
sicherte der zukünftigen Stadt „Vrankenvorde“ das alleinige Niederlagsrecht in ihrem Umkreis und mehr Land rechts der Oder zu.
Frankfurt wurde in den Akten der Lübecker Tagfahrt von 1430 als Teilnehmer genannt. Nur Mitglieder der Hanse durften an den Tagfahrten teilnehmen – folglich war Frankfurt spätestens seit
diesem Jahr Mitglied der Hanse. Hussiten brannten am 6. April 1432 die Gubener Vorstadt ab. Auch das Kartäuserkloster wurde an diesem Tag in Schutt und Asche gelegt. Ein Angriff auf die
Stadt selbst am 13. April 1432 misslang. Auf das Jahr 1454 ist der Fisch über dem südlichen Schmuckgiebel des Rathauses datiert, der wohl das Recht der „Höhung“ in den Heringsfässern
symbolisiert.
Frühe Neuzeit
Ende Januar 1506 begann mit der humanistischen Vorlesung des ersten „berufenen“ Lehrers Axungia der Lehrbetrieb an der Brandenburgischen Universität Frankfurt. Am 26. April fand in
Anwesenheit des Kurfürsten Joachim I. und dessen Bruder Albrecht die feierliche Eröffnung statt. 950 Akademiker, unter ihnen der junge Ulrich von Hutten, fanden sich im ersten Jahr ein,
mehr als an jeder anderen deutschen Universität bis dahin. Erster Rektor wurde der Leipziger Theologe Konrad Wimpina.
Martin Luther veröffentlichte 1517 in Wittenberg seine Thesen, die sich auch gegen Albrecht, inzwischen Erzbischof von Magdeburg und Mainz, richteten. Die brandenburgische Universität
reagierte mit einer Disputation am 20. Januar 1518 vor 300 Ordensbrüdern. Die dafür von dem Dominikaner und späteren Ablassprediger Johannes Tetzel eingereichten Antwortthesen hatte
jedoch Konrad Wimpina geschrieben. Sie wurden von der Versammlung gebilligt, und Luther galt damit als widerlegt. Im Folgenden wandten sich viele Studenten von Frankfurt ab und zogen nach
Wittenberg. Im gleichen Jahr schied auf Wunsch des Kurfürsten Joachim I. Frankfurt förmlich aus der Hanse aus. 1535 wurde in Frankfurt die erste bürgerliche Musiziergemeinschaft
Deutschlands convivium musicum durch Jodocus Willich gegründet. In ihr beschäftigten sich zwölf Personen mit weltlicher Musik und diskutierten dabei musikalische Fragen.
Im Oktober 1536 hielten die Hohenzollern in Frankfurt einen Familientag ab, auf dem Pläne konkretisiert wurden, verwandtschaftliche Verbindungen mit der schlesischen Linie der Piasten
herzustellen. 1548 erschien die älteste Stadtansicht von Frankfurt (Oder) in Sebastian Münsters „Cosmographia“. Der Dreißigjährige Krieg erreichte die Stadt erstmals im April 1626, als
das von Wallenstein bei Dessau geschlagene Heer Peter Ernsts II. von Mansfeld durch die Stadt in Richtung Osten flüchtete. Daraufhin forderte Kurfürst Georg Wilhelm die märkischen Stände
auf, ein stehendes Heer aufzustellen. Mit der Aufstellung von 3.000 Mann Fußvolk wurde Oberst Hillebrand von Kracht beauftragt. Am 1. Mai wurden hierfür „an den Vogelstangen nahe dem
Carthaus“ (dem heutigen Anger) neun Kompanien zu Fuß gemustert. Dieses Ereignis galt als Gründung der 4. Grenadiere und wird als Gründung des preußischen Heeres überhaupt angesehen.
Nachdem der schwedische König Gustav Adolf im Juli 1630 mit einem Heer an der pommerschen Küste gelandet war, griff er Frankfurt im Sommer 1631 an, um den brandenburgischen Kurfürsten
Georg Wilhelm in ein Bündnis mit ihm zu zwingen. Die Stadt wurde einige Tage belagert und dann folgte in der Schlacht von Frankfurt die Erstürmung und Plünderung der Stadt unter großen
Verlusten für die Verteidiger.
Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges hatte sich die Einwohnerschaft von etwa 12.000 auf 2.366 verringert. Wirtschaftlich konnte sich die Stadt von den erpressten Kriegskontributionen
nicht mehr erholen. Doch nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges 1648 gewann die Universität wieder an Bedeutung, 250 Studenten waren in jenem Jahr immatrikuliert.
Matthäus Gottfried Purmann führte 1668 in Frankfurt die erste erfolgreiche Bluttransfusion auf deutschem Boden vom Lamm auf einen Menschen durch.
Im Siebenjährigen Krieg besetzte Ende Juli 1759 eine russische Vorhut unter General de Villebois die Dammvorstadt. Die kleine Garnison unter Major von Arnim zog nach kurzer Beschießung
ab. General de Villebois forderte der Stadt 600.000 Thaler Kontributionen ab. Die später eintreffenden Österreicher stellten die gleiche Forderung. Dank des Verhandlungsgeschicks des
Oberbürgermeisters Ungnad wurde die Gesamtforderung auf 100.000 Thaler reduziert. Am 12. August 1759 erlebte Friedrich II. seine schwerste Niederlage in der Schlacht bei Kunersdorf auf
der östlichen Oderseite unweit Frankfurts. Die preußische Armee unterlag den vereinigten Russen und Österreichern. 19.000 Mann fanden den Tod; unter ihnen Ewald Christian von Kleist. Am
28. April 1785 brach während des Frühjahrshochwassers der Damm, die gesamte Dammvorstadt wurde überschwemmt. Einziges Todesopfer war Garnisonskommandant Leopold von Braunschweig, dessen
Kahn auf dem Weg zu den Rettungsarbeiten umschlug.
Frankfurt hatte für den Handel zwischen Osteuropa und Deutschland nicht nur für den von Krünitz erwähnten Fellhandel zeitweilig eine erhebliche Bedeutung. Krünitz schrieb um 1800: „Die
hiesigen [deutschen] Kürschner kaufen die ausländischen Pelze auf den Messen in Leipzig und in Frankfurth an der Oder. […] Auf der Messe in Frankfurth an der Oder finden sich vorzüglich
pohlnische Juden ein, die unter andern mit ukrainischen Schaf-Fellen handeln, und überdem zuweilen danziger, insgemein aber leipziger Rauchwerk-Händler“.
19. Jahrhundert
Anfang Februar 1811 erreichte die Frankfurter die endgültige Nachricht von der Verlegung der Universität nach Breslau. Grund war die im Vorjahr von Wilhelm von Humboldt eröffnete
Universität zu Berlin. Am 10. August fand das Abschiedsfest der Studenten statt. Als Ersatz für die Verlegung der Universität nach Breslau wurde Frankfurt zum 1. Januar 1816 Sitz der
Regierung des neuen Regierungsbezirks Frankfurt und eines Oberlandesgerichtes. Der 1816 gebildete Kreis Frankfurt setzte sich zusammen aus der Stadt Frankfurt sowie Gebieten, die bis
dahin zum Landkreis Lebus und zum Kreis Sternberg gehört hatten, darunter die Vororte Carthaus, Kliestow, Booßen, Buschmühle, Lossow, Rosengarten, Schiffersruh, Tschetschnow und Ziegelei.
In Frankfurt befand sich auch das Landratsamt für den Kreis Lebus. Zum 1. Januar 1827 wurde der Kreis Frankfurt wieder aufgelöst. Die Stadt Frankfurt war seit 1827 wieder kreisfrei, blieb
aber Kreisstadt des Kreises Lebus. Am 22. Oktober 1842 fand die Einweihung der Bahnlinie Berlin – Frankfurt (Oder) der Berlin-Frankfurter Eisenbahngesellschaft statt. 1870 wurde die
Bahnstrecke nach Posen mit der 444 Meter langen Eisenbahnbrücke über die Oder eröffnet. 1895 wurde die erste steinerne Oderbrücke eingeweiht. Am Ausgang des 19. Jahrhunderts hatte
Frankfurt an der Oder fünf evangelische Kirchen, eine katholische Kirche und eine Synagoge.
20. Jahrhundert
Das erste Flugzeug landete in Frankfurt am 19. August 1911 auf dem seit Anfang des Jahrhunderts ungenutzten Exerzierplatz Kunersdorf. Aus den nach dem Ersten Weltkrieg an Polen gefallenen
Gebieten Deutschlands kamen zwischen 1919 und 1926 8.254 Flüchtlinge nach Frankfurt. Der Verlust der Ostgebiete durch die Bildung Polens bedeutete für die Wirtschaft Frankfurts wegen des
Wegfalls von Absatz- und Bezugsmärkten eine enorme Einbuße. Ebenso wurde der Verkehr beeinflusst. Im Vergleich zu 1913 waren 1928 40 % weniger Personentransport und über ein Drittel
weniger Gütertransport auf der Bahnstrecke Frankfurt–Posen zu verzeichnen. Vom 16. bis 24. Juni 1924 fand in Frankfurt die Ostmarkschau für Gewerbe und Landwirtschaft („Ogela“) statt, die
fast 100.000 Menschen besuchten. Die Stadt erhoffte sich dadurch Impulse für die Ansiedlung von Industrie und gründete eine GmbH für das Projekt. Diese bereitete 250.000 m² Fläche in der
Dammvorstadt vor, auf welcher die vier Hauptbereiche Gewerbeschau, Landmaschinenschau, Kleintierschau und Tierschau stattfinden sollten. Die Veranstalter waren mit der Veranstaltung trotz
eines Verlustes von 100.000 Reichsmark zufrieden. Industriebetriebe wurden dadurch aber nicht angelockt.
Am 1. April 1930 wurde der Neubau der staatlichen Baugewerkschule (Höhere Technische Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau) eingeweiht.
Pädagogische Akademie Frankfurt (Oder) 1931
Ebenso erfolgte ab 1931 ein Neubau für die neue Pädagogische Akademie Frankfurt (Oder), die aus Spargründen bereits 1932 wieder geschlossen wurde, doch als Hochschule für Lehrerbildung
1934 wieder eröffnet wurde. Der Neubau in der Bismarckstr. 51/52 wurde 1935 eingeweiht.
Zeit des Nationalsozialismus
Die Nationalsozialisten sperrten ihre politischen Gegner (darunter den späteren Oberbürgermeister Willy Jentsch) ins historische Gerichtsgefängnis in der Collegienstraße, das von 1933 bis
1945 Gestapo-Gefängnis war. 1937 wurde die Autobahn nach Berlin eingeweiht. Während der Novemberpogrome 1938 wurde die Inneneinrichtung der 1822 von der damals großen jüdischen Gemeinde
erbauten Synagoge von Nationalsozialisten zerstört.
Das zerstörte Rathaus, 1951
Von Kriegshandlungen des Zweiten Weltkriegs blieb die Stadt – bis auf einen Angriff der britischen Luftwaffe Anfang 1944 – bis 1945 weitgehend verschont, da es kaum wichtige Industrie-
oder Militäranlagen gab. Mit dem Beginn der Weichsel-Oder-Operation der sowjetischen Streitkräfte setzte eine große Flüchtlingswelle der Deutschen ein, welche auch durch Frankfurt (Oder)
zog. Die Zahl der insgesamt durchziehenden Flüchtlinge belief sich auf 264.000 bis 300.000 Menschen. Die Stadt wurde am 26. Januar 1945 zur Festung erklärt. Am 19. April um 5:29 Uhr
morgens wurde die Oderbrücke von der Wehrmacht gesprengt. Russische Fliegerangriffe fanden ab dem 20. April statt. Am Nachmittag des 21. April wurde der Festungsstatus aufgehoben und
einen Tag später begann der Rückzug der Festungstruppen. Am 22. und 23. April flogen sowjetische Bomber weitere Angriffe. Dadurch kam es vor allem im Zentrum Frankfurts zu zahlreichen
Bränden. Am Morgen des 23. April 1945 erreichten die ersten sowjetischen Einheiten Frankfurt. Durch das vorherige Bombardement und Brandstiftungen, welche in den folgenden Tagen
einsetzten, wurde die Innenstadt zu 93 % zerstört. Am Abend des 24. April brannte der Turm der Marienkirche, das Gewölbe der Kirche stürzte Monate später ein. Zwischen 1933 und 1945 kamen
tausende Frankfurter durch die Nationalsozialisten zu Tode. Bis 2018 wurden mehr als 170 von ihnen ein Stolperstein gesetzt.
SBZ/DDR
Deutscher Grenzstein an der Oder
Schon im Mai 1945 wurde durch eine provisorische Brücke die Verbindung zur Dammvorstadt wiederhergestellt. Entsprechend dem Potsdamer Abkommen wurde Frankfurt (Oder) – abgekürzt Ffo –
Grenzstadt. Die Dammvorstadt wurde abgetrennt, innerhalb von zwei Tagen vollständig geräumt und unter polnische Verwaltung gestellt. Daraus entstand die heutige polnische Nachbarstadt
Frankfurts, Słubice. 1952 wurde in Frankfurt der Vertrag über die Markierung der Staatsgrenze der DDR zu Polen unterzeichnet (nach dem Görlitzer Abkommen 1950). Die Bundesrepublik
erkannte diese Grenze bis 1970 (Warschauer Vertrag) nicht an, endgültig erst 1990. Mit der Auflösung der Länder, darunter Brandenburgs, durch die DDR wurde Frankfurt (Oder) 1952
Bezirksstadt. 1957 wurde die Autobahnbrücke über die Oder fertiggestellt. Das Stadtzentrum wurde in den 1950/60er Jahren unter weitgehender Aufgabe des alten Stadtgrundrisses neu
aufgebaut. Nur wenige historische Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus, wurden wiederhergestellt. In den 1970er und 1980er Jahren entstanden mehrere großflächige Neubaugebiete in
Plattenbauweise, darunter Hansa Nord, Südring und Neuberesinchen.
Friedliche Revolution und deutsche Einheit
Am 1. November 1989 folgten 35.000 Menschen dem Aufruf des Neuen Forums zum Protestmarsch gegen die SED: Die zentrale Kundgebung fand auf dem Brunnenplatz statt, woran ein Denkmal mit
Worten aus der Rede des Arztes Karl-Ludwig von Klitzing erinnert: „Wir brauchen eine vollkommene Demokratisierung, Reisefreiheit, Rede- und Pressefreiheit, Chancengleichheit, Perspektiven
für jeden einzelnen, ein besseres Bildungssystem. Und wir brauchen wirksame Kontrollen. Die friedliche Demonstration soll kundgeben, dass wir alle hier für die Wende sind, an ihr
mitarbeiten, sie mittragen, sie dringend fordern.“
Mit der Wiederherstellung der Länder noch in der DDR 1990 kam die Stadt wieder zum Land Brandenburg. Am 15. Juli 1991 wurde die offizielle (Neu-)Gründung der Europa-Universität Viadrina
vollzogen. Im September 1994 verließ der letzte Besatzungssoldat der sowjetischen Armee die Stadt.[26][27] 2001 begann der größere Abriss von Häusern, hauptsächlich Plattenbauten, aus der
DDR-Zeit. Bis einschließlich 2005 verlor die Stadt so 3.500 weitgehend leerstehende Wohnungen. Jüdisches Leben in der Stadt.
Ab spätestens 1294 lebten Juden in der Stadt. Der Judenfriedhof wurde erstmals 1399 erwähnt. Bei einem Pogrom 1491/1492 wurden alle Juden getötet. 1561 wurde eine neue Synagoge errichtet
und 1697–1699 wurde erstmals in Deutschland der Talmud gedruckt.
1933 lebten etwa 800 Juden in der Stadt, die zu einem großen Teil nach dem Ersten Weltkrieg aus Posen und Westpreußen zugewandert waren, da sie sich als Deutsche fühlten und nicht in
Polen leben wollten. In der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge angezündet und brannte aus. Jüdische Geschäfte wurden geplündert und zerstört, jüdische Familienväter verhaftet und in das
KZ Sachsenhausen verschleppt. Das Synagogengebäude wurde später als Lagerraum genutzt und in den 1950er Jahren zur Errichtung von Wohnraum abgerissen. Eine Gedenktafel und in die Fahrbahn
eingelassene Messingstreifen erinnern an sie.
1944 lebten nach der erzwungenen Ausreise und den Deportationen in den Tod nur noch 62 Juden in Frankfurt (Oder). In der SBZ/DDR spielte die jüdische Geschichte kaum eine Rolle. Seit 1998
gibt es nach der Einwanderung durch Juden aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion nach Frankfurt (Oder) wieder eine jüdische Gemeinde, die 2017 mehr als 240 Mitglieder zählte und ein
Gemeindezentrum im Stadtgebiet Halbe Stadt, jedoch keine Synagoge besitzt. Der neue jüdische Friedhof wurde am 27. Juni 2011 im Frankfurter Stadtteil Südring eingeweiht.
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Frankfurt (Oder) von 1871 bis 2017
Die Bevölkerungszahl von Frankfurt (Oder) stieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. So
verlor die Stadt durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges 82 % ihrer Bewohner. Die Einwohnerzahl sank von 13.000 im Jahre 1625 auf nur noch 2.366 im Jahre 1653. Erst mit dem
Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1816 15.600 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits 62.000.
Die Halbierung der Einwohnerzahl von 83.000 im Jahre 1939 auf 42.000 im Dezember 1945 ist auf die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und die Abtrennung des Stadtteils Dammvorstadt – der
heutigen polnischen Stadt Słubice – zurückzuführen. 1980 gab es in der Stadt 1.471 Geburten, davon 766 Jungen, und 80.414 Einwohner, wovon 42.241 Frauen waren. Die Bevölkerung wuchs dabei
im Vergleich zu 1979 um 1.461 Menschen.[32] Im Jahre 1988 erreichte die Bevölkerungszahl der Stadt Frankfurt (Oder) mit 88.000 ihren historischen Höchststand. Zur DDR-Zeit profitierte
Frankfurt davon, dass die Versorgungslage und Wohnraumsituation in den Bezirksstädten deutlich besser war als in den anderen Regionen. Inzwischen ist die Einwohnerzahl jedoch wieder stark
gesunken.
Am 30. Juni 2005 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Frankfurt (Oder) nach Fortschreibung des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg 64.429 (nur
Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern), am 31. Dezember 2005 nach gleicher Quelle nur noch 63.748 Einwohner (30.877 männlich, 32.871 weiblich). Dagegen waren es an
diesem Tag nach Angaben der Stadtverwaltung 63.210 Menschen. Davon waren 30.389 männlich und 32.731 weiblich. Mit Hauptwohnsitz waren 2.488 ausländische Bürger in der Stadt gemeldet. Seit
der Wende und friedlichen Revolution in der DDR im Jahre 1989 hat die Stadt wegen der hohen Arbeitslosigkeit und des Geburtenrückgangs fast 30 Prozent ihrer Bewohner (28.000 Personen)
verloren.
Schätzungen, die 2009 veröffentlicht wurden, gingen davon aus, dass Frankfurt bis 2025 etwa 28 bis 30 Prozent seiner Bevölkerung verlieren würde, sodass sich die Einwohnerzahl dann auf
unter 44.000 belaufen würde, was mehr als eine Halbierung seit 1988 bedeuten würde. Eine im Auftrag der Stadt erstellte Bevölkerungsprognose (basierend auf Daten der Jahre 2005 bis 2008)
prognostizierte hingegen einen moderateren Bevölkerungsrückgang. Nach dieser Studie sollte die Einwohnerzahl für das Jahr 2020 weniger als 54.000, für 2025 etwas über 51.000 und für 2030
etwa 48.500 Menschen betragen. Tatsächlich lebten nach Angaben von Statistik Berlin-Brandenburg im Dezember 2017 rund 58.200 Menschen in Frankfurt (Oder).
Das 1992 genehmigte Wappen der Stadt
Offizielle Blasonierung: „In Silber auf grünem Berg aufgerichtet stehend ein goldbewehrter roter Hahn im Kleeblattbogen eines von zwei sechseckigen Türmen beseiteten offenen, roten
Torbaus; darüber schwebt ein silberner Schild mit rotem Adler; auf den goldbeknauften Dächern der Seitentürme steht je ein abgewendeter, widersehender goldener Vogel; der breitgedachte
Mittelturm ist an den Ecken mit je einem goldenen Kreuz versehen.“
Korrekte Blasonierung: „In Silber auf grünem Bogenschildfuß ein stehender, goldbewehrter, roter Hahn unter dem Kleeblattbogen eines von zwei wachsenden, sechseckigen, gezinnten, roten
Türmen mit goldbeknauften Dächern, darauf je ein widersehender goldener Vogel, der linke abgewendet, beseiteten offenen, roten Torbaus mit einem wachsenden, breiten roten Mittelturm mit
goldbekreuzten Satteldachenden, mittig einen silbernen Schild mit rotem Adler tragend.“
Bereits das Siegel von 1294, das älteste erhaltene, zeigt das Wappen der Stadt in seiner heutigen Form. Es zeigt einen roten Hahn mit rotem Kamm, goldenen Füßen und Schnabel. Dabei
handelt es sich um ein redendes Wappen: gallus ist das lateinische Wort für Hahn, aber die galli sind im mittelalterlichen Latein die Franken („Gallier“). Über dem Tor schwebt seit 1990
wieder, wie schon in der ältesten Wappenabbildung, ein Wappenschild mit dem Märkischen Adler.
Kinderbetreuung
1993 gab es 72 Kindertagesstätten. 2011 standen 38 Kindertagesstätten in Trägerschaft von 21 freien Trägern, 7 Kindertagespflegestellen sowie drei pädagogisch begleitete Spielgruppen zu Verfügung. Von den Kindertagesstätten waren fünf integrative Einrichtungen.[52] Im Jahr 2000 öffnete mit der Eurokita der erste deutsch-polnische Kindergarten Frankfurts.[53]
Sport
Hermann Weingärtner bei den 1. Olympischen Spielen der Neuzeit
Frankfurt (Oder) ist ein Zentrum des Sports im Land Brandenburg. Neben dem Olympiastützpunkt, der Bundeswehrsportfördergruppe und der Sportschule treiben in den 13
Landesleistungsstützpunkten und den 83 im Stadtsportbund zusammengeschlossenen Sportvereinen über 10.000 Mitglieder Spitzen- und Breitensport. Eine herausragende Rolle im Vereinssport
spielt die Frankfurter Sportunion 90, die ein Drittel aller Sporttreibenden der Stadt, insbesondere der Spitzensportler, vereint. Die Stadt verfügt über zwei Stadien, das Stadion der
Freundschaft und das Fritz-Lesch-Stadion, mit insgesamt etwa 5.000 Sitz- und 12.000 Stehplätzen (2014). Hinzu kommen 14 Großfeldplätze.
Hermann Weingärtner aus Frankfurt (Oder) gewann bei den 1. Olympischen Spielen in Athen 1896 drei Goldmedaillen im Turnen. Als Zentrum des Boxsports wurde die Oderstadt durch den
Profiboxweltmeister und heutigen Ehrenbürger der Stadt Henry Maske wie auch durch den Profiboxer Axel Schulz weltbekannt. Erfolgreichster Vertreter des Traditionsreichen Ringerzentrums
ist der heutige Bundestrainer Maik Bullmann, Olympiasieger 1992 und dreifacher Weltmeister. Die Frauen des Frankfurter Handball Club wurden 2004 Deutscher Meister. Der Frankfurter
Sportschütze, Manfred Kurzer, Schützengilde Frankfurt a.d. Oder 1406, wurde 2004 in Athen Olympiasieger in der Disziplin Laufende Scheibe. Wichtigster Fußballverein ist der in der Saison
2018/2019 in der Brandenburg-Liga spielende 1. FC Frankfurt.
Freizeit/Erholung
Erholung finden die Frankfurter unter anderem im Wildpark Frankfurt (Oder), am Helenesee oder einem der anderen Seen im Stadtgebiet und der näheren Umgebung, in den Parks der Stadt, in den Stadtforsten oder im Eichwald.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Im Frankfurter Stadtgebiet gibt es eine große Zahl von Kunstwerken, die im Artikel Kunst im öffentlichen Raum in Frankfurt (Oder) genauer beschrieben sind.
Theater
Das Kleist Forum wurde am 30. März 2001 gegründet. Das Haus mit seiner beeindruckenden Architektur bietet ein weitgefächertes Programm, das von der klassischen Oper und Operette über
Schauspiel, von Jazzkonzerten, internationalen Festivals wie den deutsch-polnischen Musikfesttagen, Kinder- und Schülertheater bis hin zu Lesungen, Diskussionsforen und
Varietéveranstaltungen reicht. Es ist der jährliche Mitveranstalter der Kleist Festtage. Außerdem ist das Kleist Forum Veranstaltungsort für Tagungen und Kongresse.
Die Konzerthalle C. P. E. Bach ist eine ehemalige Franziskanerkirche aus dem 13. Jahrhundert. Das ganze Jahr über finden vielfältige Veranstaltungen wie die Deutsch-Polnischen
Musikfesttage an der Oder, Musikreihen und Abonnements in klassischen und unterhaltenden Genres, Orgelkonzerte, Besichtigungen, Führungen und Ausstellungen statt. Das deutsch-polnische
Theaterfestival Unithea[54] ist ein von Studierenden der Universität Viadrina konzipiertes und organisiertes Theaterfestival, welches seit über 15 Jahren in den Städten Frankfurt (Oder)
und Słubice stattfindet.
Die Oderhähne
Die Oderhähne, ein satirisches Theater und Kabarett, entwickelte sich aus der im Jahr 1976 gegründeten Feierabendbrigade Lach mit am Frankfurter Kleist-Theater. Seit 1991 sind Die
Oderhähne ein gemeinnütziger Verein. Über 200-mal im Jahr treten sie im Fett- und Futternapf herum, die ihnen Politik und Gesellschaft nur allzu bereitwillig hinstellen. Im liebevoll und
aufwendig sanierten Rathauskeller treiben die Hofnarren ihr Unwesen.
Das Theater des Lachens ist hervorgegangen aus dem 1975 gegründeten Staatlichen Puppentheater Frankfurt (Oder). 1992 wurde die von der Kommune zur Nutzung überlassenen Spielstätte des
ehemaligen Puppentheaters von Spielern und Mitarbeitern übernommen. Sie gründeten das Kleine Theater, Puppen- und Schauspiel e. V. Mit Inszenierungen wie Dantons Tod wurde das
Puppentheater mit der damaligen künstlerischen Leiterin Astrid Griesbach auch über die Grenzen der Stadt bekannt. Mit seinem Umzug 1996 in die Ziegelstraße 31 nennt sich das einzige
professionelle Puppentheater Brandenburgs nun Theater des Lachens.
Theater Frankfurt – Das Theater im Schuppen e. V. gründete sich im Jahr 1990. Seit 1995 bewirtschaftete es ein eigenes Haus, welches aus einem Bühnenraum, einem Foyer und zahlreichen
Trainings- und Probenräumen besteht und in den Gerstenberger Höfen, in der Ziegelstraße, seinen Sitz hatte. Seit Oktober 2006 werden in der "Theaterschule für Körper & Bildung
Frankfurt (Oder)" staatlich anerkannte Schauspieler/innen ausgebildet. Im Jahr 2011 zogen das Theater und die Schauspielschule in ihr neues Domizil, in die Sophienstraße 1. Das Moderne
Theater Oderland (MTO) hat seine Räumlichkeiten in der Ziegelstraße 28a in den Gerstenberger Höfen. Gezeigt werden eigene und Fremdproduktionen. Auch Konzerte sind Teil des Programms.
Museen
Das Sportmuseum im Zentrum der Stadt wurde am 11. Juli 2003, aus Anlass der 750-Jahr-Feier der Oderstadt an den Oberbürgermeister übergeben. Frankfurter Sportgeschichte wird zwischen
vielen Bildern, Trophäen und Erinnerungsstücke dokumentiert. Der Verein Sportgeschichte Frankfurt (Oder) e. V. möchte jedoch nicht nur Erinnerungen wecken, sondern insbesondere auch junge
Menschen zu eigener sportlicher Betätigung anregen.
Das Kleist-Museum
Das Kleist-Museum wurde 1969 im Gebäude der ehemaligen Garnisonsschule eingerichtet. Die Dauerausstellung umfasst vier Räume. Die etwa 250 Dokumente geben einen Überblick über Kleists
Leben und Werk. Das Haus verfügt mit etwa 34.000 Bestandseinheiten, darunter etwa 10.000 Bände Spezialliteratur zu Kleist und seinem literaturgeschichtlichen Umfeld, über die derzeit
umfangreichste Kleist-Sammlung. Das Arbeitsprofil des Museums beruht auf einem abgestimmten Zusammenspiel von Sammlungs-. Ausstellungs-, Forschungs-, Publikations- und
Veranstaltungstätigkeit. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören unter anderem Wechselausstellungen, Lesungen und Vorträge. Die jährlichen Kosten betragen 500.000 Euro. Das Museum
erwirtschaftet dabei durch Eintrittserlöse und Spenden 50.000 €, der restliche Betrag wurde zu 50 % vom Bund, 35 vom Land Brandenburg und 15 % von der Stadt getragen.
Das Museum Junge Kunst stellt in zwei Häusern, dem Rathaus mit Rathaushalle und dem gotischen Festsaal sowie im PackHof des Museums in der C.-Ph.-E.-Bach-Straße mit einer der
wesentlichsten Sammlung Kunst aus dem Osten Deutschlands aus. Über 11.000 Werke der Malerei, Handzeichnungen und Aquarelle, Druckgrafik, Skulpturen sowie polnische Grafik sind im Besitz
des Museums.
Das Museum Viadrina ist das kulturhistorische Museum für die Stadt Frankfurt. Seinen Sitz hat es im Junkerhaus, in einem wertvollen, überregionalen, barocken Baudenkmal. Es handelt sich
hierbei um eines der wenigen Gebäude im Stadtzentrum, die am Ende des Zweiten Weltkrieges von der Vernichtung verschont blieben. Seine Architektur und Geschichte ist für Frankfurt und das
Land Brandenburg von ganz besonderer Bedeutung. Das Gebäude mit seinen wertvollen originalen Stuckdecken vom Ende des 17. Jahrhunderts war die kurfürstliche bzw. königliche Residenz der
Hohenzollern, also das Stadtschloss Frankfurts. Nach mehr als 15-jähriger Bautätigkeit ist es seit dem 4. Oktober 2003 mit einer neuen Dauerausstellung vollständig geöffnet. Sie bietet
die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen der Stadt- und Regionalgeschichte zu beschäftigen.
Kulturelle Projekte
Das Verbündungshaus fforst e.V. ist ein im Herzen Europas gelegenes, von Studenten initiiertes Grenzen überwindendes, gemeinnütziges und selbstverwaltetes Wohnprojekt, in dem Menschen mit verschiedenen Ansichten, vielfältigsten Eigenschaften und unterschiedlichster Herkunft sich zusammentun mit dem Ziel, einen Raum zur kreativen Gestaltung zu schaffen, sowohl für interkulturelles Zusammenleben als auch für die Umsetzung von Ideen durch Projekte und Veranstaltungen. Der 2006 gegründete Verein wird von der Europa-Universität Viadrina unterstützt und mietet zu einem symbolischen Preis seine Räumlichkeiten von der Wohnwirtschaft Frankfurt (Oder) (WoWi). Sowohl die Universität als auch die WoWi sind – neben anderen – in vielen Belangen Kooperationspartner. Im Erdgeschoss des Vereinshauses befindet sich ein öffentlicher Veranstaltungsort, an dem unter anderem Internationale Abende, Konzerte, Lesungen, Theaterstücke und Filmpremieren stattfinden. Darüber leben in 13 Mietparteien die Vereinsmitglieder in 2er- bis 4er-Wohngemeinschaften. Die Bewohner engagieren sich freiwillig bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltungen sowie für den Erhalt des Projekts.
Marienkirche
Die St.-Marien-Kirche ist die ehemalige Hauptpfarrkirche Frankfurts. 1253 wurde mit dem ursprünglichen Bau in den Formen der norddeutschen Backsteingotik begonnen.[56] Durch
Kriegseinwirkung war sie 1945 nur noch eine Ruine. Rekonstruktionen finden seit 1979 statt. Seit den 1990er Jahren wurde sie zum soziokulturellen Zentrum St. Marien umgebaut. Im Jahr 2002
gab Russland 111 mittelalterliche Bleiglasfensterfelder zurück.
Die Ende des 13. Jahrhunderts errichtete Franziskaner-Klosterkirche am Untermarkt beherbergt seit 1969 die Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“. Die Konzerthalle in Frankfurt (Oder)
ist ein ehemaliges Kirchengebäude.
Die Friedenskirche am Untermarkt ist der im Ursprung älteste Steinbau der Stadt. Sie existierte bereits zur Stadtgründung 1253 als St.-Nikolai-Kirche, war aber mit der Weihung der
Marienkirche zu Beginn des 14. Jahrhunderts nicht mehr die Hauptkirche der Stadt. Nachdem Mitte des 16. Jahrhunderts die Gottesdienste in die Franziskaner-Klosterkirche verlagert worden
waren, wurde die Nikolaikirche zeitweilig als Kornhaus, Heuschuppen, Pulvermagazin und zur Unterbringung von Kranken und Gefangenen genutzt. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts fanden in dem
Gebäude Gottesdienste der Reformierten Gemeinde statt. Die nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend unbeschädigte Kirche wurde zu Beginn der 1990er-Jahre soweit instand gesetzt, dass sie
im Bestand gesichert ist. Die Friedenskirche wird mithilfe von Fördergeldern zum „Oekumenischen Europa-Zentrum“ umgebaut.
Die Sankt-Gertraud-Kirche ist ein dreischiffiger neugotischer Backsteinbau, der 1874 etwa 200 m südlich des Vorgängerbaus, einer 1368 errichteten Kapelle der Gewandschneider, erbaut
wurde. Um 1930 wurde umfassend Bauschmuck entfernt. Bei einem Umbau 1978 bis 1980 wurde im Chorraum eine Zwischendecke auf Höhe der ehemaligen Emporen eingezogen. Im unteren Teil
entstanden Büro- und Gemeinderäume. In der Sankt-Gertraud-Kirche befinden sich seit 1980 Hochaltar, siebenarmiger Leuchter, Bronzetaufe und zahlreiche Epitaphe aus der Marienkirche.
Die evangelische Sankt-Georg-Kirche wurde von 1926–1928 errichtet. Die Rundkirche wurde im expressionistischen Stil als Stahlbetonbau ausgeführt und mit Backstein verkleidet. Ihr Anfang
des 14. Jahrhunderts entstandener Vorgängerbau war 1926 wegen Baufälligkeit abgerissen worden.
Die katholische Heilig-Kreuz-Kirche wurde 1899 eingeweiht. 1967 wurde der Innenraum instand gesetzt und stark vereinfacht. Die Heilandskapelle in der Heimkehrsiedlung wurde während des
Ersten Weltkriegs 1915/16 von kriegsgefangenen Angehörigen der zaristischen russischen Armee erbaut. Sie diente Katholiken, Protestanten, Evangeliums-Christen, Russisch-Orthodoxen und
Juden jeweils getrennt als Gotteshaus. Außerdem diente das Gebäude Gefangenen und Wachmannschaften als Lesehalle und für Theater- und andere kulturelle Aufführungen.
Weitere Gotteshäuser in Frankfurt sind die Neuapostolische Kirche, die Katholisch-Apostolische Kirche, eine Kapelle im Wichernheim und eine Kapelle im Lutherstift.
Dorfkirchen
Die Dorfkirche in Booßen wurde um 1250 als Wehrkirche gebaut. Im Dreißigjährigen Krieg bis auf die Umfassungsmauern zerstört, erfolgte 1671 der Wiederaufbau im Renaissance-Stil. 1961
wurde die Kirche völlig umgestaltet. Die Kliestower Dorfkirche entstand um 1300 als rechteckiger Feldsteinbau. Der Turm wurde Ende des 15. / Anfang des 16. Jahrhunderts errichtet.
Die Dorfkirche in Lossow wird im Lebuser Stiftregister 1405 erstmals erwähnt. Wegen Baufälligkeit wurde 1741–1748 eine neue Kirche errichtet. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs brannte die
Kirche aus. Nach Sicherungsarbeiten ist die Kirchenruine begehbar. Die neobarocke Dorfkirche in Rosengarten wurde 1903 geweiht.
Die Kirche in Lichtenberg ist im Kern ein frühgotischer Feldsteinbau. Das Kirchenschiff stammt aus der zweiten Hälfte des 13. beziehungsweise der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Um
1700 erfolgte eine barocke Umgestaltung der Kirche. In den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde die Kirche zerstört. 1950 brach der Dachstuhl ein. Seit 2001 bemüht die
Gemeinde von Lichtenberg um einen Wiederaufbau. Der 2015 wiedererrichtete Glockenturm wurde 2018 fertig eingedeckt. Ende 2018 erhielt er eine Glocke, die aus der 2014 zur Synagoge
umgewidmeten Cottbusser Schlosskirche stammt. Der Turm der 1607 geweihten Kirche in Hohenwalde wurde 1784 neu aufgebaut. Im Innern befindet sich ein reich gestalteter
Renaissance-Altar.
Die Dorfkirche in Güldendorf wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im frühgotischen Stil aus Feldsteinen erbaut. Der Kirchturm wurde im 15. Jahrhundert errichtet und 1773
umgebaut. Nach einem Blitzschlag brannte im Juni 1945 dort gelagerte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg unter Explosionen ab. 1951/1952 bekam die Kirche ein neues Dach.
Denkmäler
Die Friedensglocke (Frankfurt (Oder)) wurde von der CDU der DDR zum 6. Parteitag am 27. Januar 1953 zur Erinnerung an die Unterzeichnung des Oder-Neiße-Friedensvertrages gestiftet. Sie
ist somit ein Symbol der Freundschaft für die deutsch-polnischen Beziehungen. Jährlich am 1. September zum Weltfriedenstag wird sie traditionsgemäß geläutet.
Reliefwand Geschichte der Alten Universität
Am Rand des Lennéparks befindet sich die Reliefwand Geschichte der Alten Universität. Die rund zehn Meter lange Wand aus Sandstein wurde in den 1980er Jahren von Walter Kreisel
geschaffen. Die Stadt hatte den Künstler beauftragt, allerdings dauerte es vier Jahre vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung. Die Wand zeigt Porträts alter Professoren, und es befindet
sich das nachempfundene Portal der alten Universität in der Mauer. Das Portal befindet sich an der Stelle des ehemaligen Kollegienhauses, das 1962 abgerissen wurde.
Unweit des Bahnhofes befindet sich das Eisenbahnerdenkmal. Es erinnert an die gefallenen Eisenbahner des Ersten Weltkrieges und der folgenden Grenzlandkämpfe. Der Beschluss zur
Spendensammlung für das Ehrenmal wurde vom Bezirksverband der Eisenbahner 1931 einstimmig angenommen. Der Entwurf stammt vom Reichsbahnrat und Architekten Wilhelm Beringer, die Ausführung
lag beim Bildhauer Georg Fürstenberg. Die drei Stelen symbolisieren dabei die Direktionsbezirke Posen, Westpreußen und Danzig, der gemeinsame Sockel die Vereinigung in der
Reichsbahndirektion Osten. Die Einweihung erfolgte am 3. Juli 1932.
Schienenverkehr / Bahnhof
Folgende Regionalbahnlinien des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg berühren den Frankfurter Bahnhof:
RE 1: Magdeburg – Brandenburg – Potsdam – Berlin – Frankfurt – Eisenhüttenstadt – Cottbus
RB 11: Frankfurt – Eisenhüttenstadt – Cottbus (bedient mehr Bahnhöfe dieser Strecke als RE 1)
RB 36: Frankfurt – Müllrose – Beeskow – Wendisch Rietz – Königs Wusterhausen
RB 60: Frankfurt – Seelow – Wriezen – Bad Freienwalde – Eberswalde
RB 91: Frankfurt – Rzepin – Zielona Góra
Außerdem hat Frankfurt weitere Bahnhöfe.
Dieser Artikel basiert auf dem freien Enzyklopädie Wikipedia-Artikel über diesen Ort und steht unter der Lizenz Creativ Commons Attribution/ShareAlike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO
 Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO
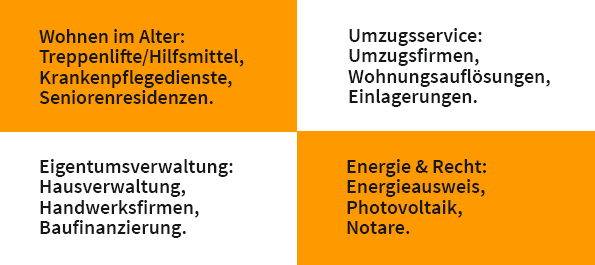 Immobilienwirtschaft Matthias Wedel CEO
Immobilienwirtschaft Matthias Wedel CEO  Matthias Wedel CEO
Matthias Wedel CEO